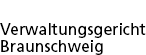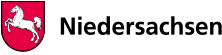Außerschulische Therapie einer Leistungsschwäche auf Kosten der Jugendhilfe?
Verwaltungsgericht konkretisiert Voraussetzungen für finanzielle Ansprüche bei Dyskalkulie und Legasthenie
Schüler mit einer sog. Teilleistungsschwäche wie Dyskalkulie (Rechenschwäche) und Legasthenie haben nur unter engen Voraussetzungen einen Anspruch darauf, dass ihnen aus Mitteln der Jugendhilfe eine Therapie in einem privaten Institut finanziert wird. Das hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts in einem heute verkündeten Urteil entschieden.
In dem Verfahren ging es um die Klage einer 8 Jahre alten Drittklässlerin aus dem Landkreis Peine, die seit August letzten Jahres wegen Dyskalkulie an einer außerschulischen Einzelförderung im braunschweiger Peter-Martens-Institut teilnimmt. Die Schülerin wollte erreichen, dass der Landkreis die dafür entstehenden Kosten aus Mitteln der Jugendhilfe übernimmt. Zur Begründung machte sie geltend, sie leide unter starken Ängsten, was das Fach Mathematik angehe. Der Landkreis hatte die Kostenübernahme unter Berufung auf die gesetzlichen Regelungen abgelehnt.
Die 3. Kammer hat entschieden, dass die Schülerin die Übernahme der Kosten nicht verlangen könne. Eine Teilleistungsschwäche wie Dyskalkulie oder Legasthenie reiche für einen Anspruch von Kindern oder Jugendlichen auf eine sog. Eingliederungshilfe nicht aus. Nach dem Sozialgesetzbuch müsse die Jugendhilfe Therapiekosten nur unter zwei Voraussetzungen übernehmen: Erstens muss ohne die Therapie eine seelische Störung von längerer Dauer (mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate) vorliegen oder drohen. Dies könne - so die Kammer - bei einer Teilleistungsschwäche der Fall sein, wenn nach fachärztlichen Feststellungen als Folge dieser Beeinträchtigung psychische Störungen eintreten (sog. sekundäre Neurotisierung). Zweitens verlangt das Gesetz für eine Kostenübernahme, dass die festgestellte seelische Störung die Teilhabe des Kindes am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder dass eine solche Beeinträchtigung droht. Schulprobleme oder Schulängste reichen dafür - so die Kammer - nicht aus. Es müssten darüber deutlich hinausgehende behinderungsrelevante Probleme vorliegen, z. B. eine auf Versagensängsten beruhende Schulphobie oder eine totale Schul- und Lernverweigerung, die zum Rückzug aus jedem sozialen Kontakt und zur Vereinzelung in der Schule geführt hat bzw. zu führen droht.
Danach habe die Klage hier keinen Erfolg. Es könne jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass die Fähigkeit der Klägerin, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben, beeinträchtigt sei oder eine solche Beeinträchtigung drohe. Das Umfeld und das soziale Verhalten der Schülerin seien positiv. Sie lebe in einer normalen, sie stützenden und unterstützenden Familiensituation. In ihren Zeugnissen werde ihr Sozialverhalten durchweg positiv bewertet; ihr Kontakt zu Mitschülern sei ungestört. Sie sei Mitglied in einem Sportverein und spiele gern mit ihren Freundinnen. Es sei nicht ersichtlich, dass die dargelegten Schulängste erheblich von alterstypischen Problemen abweichen.
(Aktenzeichen: 3 A 78/05)