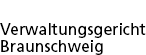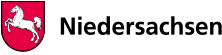Verwaltungsgericht weist Klage der Initiative Bürgerbegehren Schlosspark ab
Das für die Erhaltung des Braunschweiger Schlossparks eintretende Bürgerbegehren ist unzulässig. So hat das Verwaltungsgericht Braunschweig heute nach einer mündlichen Verhandlung entschieden.
Die Klägerin – die Initiative "Bürgerbegehren Schlosspark" – hatte ein Bürgerbegehren mit mehr als 30 000 Unterschriften bei der Stadt Braunschweig eingereicht. Ziel der Initiative ist es, den Schlosspark in Braunschweig als Parkanlage und Erholungsfläche zu erhalten. Die Stadt dagegen plant, im Schlosspark von einem privaten Investor ein Einkaufszentrum mit Rekonstruktion der historischen Schlossfassade errichten zu lassen. Der Verwaltungsausschuss der Stadt hatte entschieden, das Bürgerbegehren sei unzulässig. Hiergegen hatte die Initiative Ende März Klage erhoben.
Das Gericht hat die Rechtsauffassung des Verwaltungsausschusses bestätigt und entschieden, dass das Bürgerbegehren nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist eingereicht worden ist. Außerdem gehe es um ein Thema, mit dem sich ein Bürger-begehren nach dem Gesetz nicht befassen dürfe.
Für Bürgerbegehren, die sich gegen einen Ratsbeschluss richten, gelten nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung besondere Fristen: Sie sind nicht nach 6 Monaten, sondern in einer Frist von 3 Monaten nach der Bekanntmachung des Beschlusses bei der Stadt einzureichen. Nach Auffassung des Gerichts galt diese verkürzte Frist auch hier. Das Bürgerbegehren richte sich gegen den im Juli 2003 bekannt gemachten Ratsbeschluss über den Bebauungsplan "Einkaufszentrum
Schlosspark", weil es ein anderes Gestaltungskonzept verfolge als dieser Beschluss. Auch einige Äußerungen von Vertretern der Bürgerinitiative zeigten, dass das Bürgerbegehren gegen die Planungsabsichten der Stadt gerichtet sei. Die Klägerin hat das Bürgerbegehren erst im Dezember 2003 und nach Auffassung des Gerichts da-mit zu spät bei der Stadt eingereicht.
Nach den gesetzlichen Regelungen ist es unerheblich, so das Gericht, dass der Ratsbeschluss noch gar nicht gefasst war, als die Klägerin der Stadt die Einleitung des Bürgerbegehrens angezeigt hat: Es komme allein darauf an, ob das Bürgerbe-gehren im Zeitpunkt seines Eingangs bei der Stadt – also bei Einreichung der Unter-schriftenlisten im Dezember 2003 – zulässig gewesen sei. Der Gesetzgeber habe mit der verkürzten Frist sicherstellen wollen, dass die Gemeinden Ratsbeschlüsse im Interesse einer effektiven und sparsamen Verwaltung zügig umsetzen können, ohne noch mit Änderungen durch einen Bürgerentscheid rechnen zu müssen.
Das Gericht stellt in seinem Urteil außerdem auf die gesetzliche Regelung ab, nach der ein Bürgerbegehren "über die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen" unzulässig ist. Ein solcher Fall liege hier vor, weil das Bürgerbegehren sich gegen den Ratsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes und die darin zum Ausdruck gekommenen bauplanerischen Vorstellungen der Stadt Braunschweig richte. Der Gesetzgeber habe sicherstellen wollen, dass Bürgerbegehren keinen Einfluss haben auf die Bauleitplanung der Gemeinden. Denn für die in den Planungsverfahren zu treffenden Entscheidungen seien eine Vielzahl öffentlicher und privater Inte-ressen gegeneinander abzuwägen, die sich "nicht in das Schema einer Abstimmung mit ‚Ja’ oder ‚Nein’ pressen lassen".
(Aktenzeichen: 1 A 103/04)